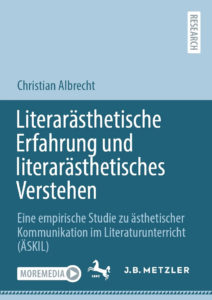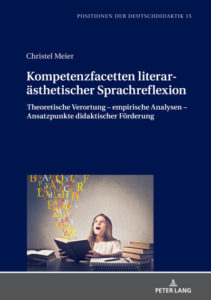Aktuelle Publikationen
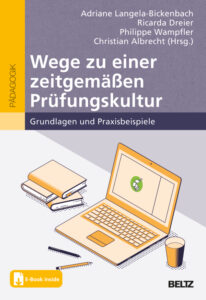 Veränderungen der Lernkultur, Digitalisierung sowie pädagogische Reflexion haben zu einer Kritik der traditionellen Prüfungskultur geführt. Viele Prüfungen sind aus pädagogischer und didaktischer Perspektive fragwürdig, weil Schülerinnen und Schüler im Prüfungssetting nicht so arbeiten können, wie sie das beim Lernen sonst machen.
Veränderungen der Lernkultur, Digitalisierung sowie pädagogische Reflexion haben zu einer Kritik der traditionellen Prüfungskultur geführt. Viele Prüfungen sind aus pädagogischer und didaktischer Perspektive fragwürdig, weil Schülerinnen und Schüler im Prüfungssetting nicht so arbeiten können, wie sie das beim Lernen sonst machen.
Dieses Buch zeigt konstruktive und argumentative Wege auf, um dieser Kritik mit einer zeitgemäßen Praxis zu begegnen, die in den Schulen umsetzbar ist. Wie können Schülerinnen und Schüler heute Leistungen erbringen und von Lehrpersonen darauf hilfreiche Rückmeldungen erhalten? Worauf müssen Schulen und Lehrpersonen achten, wenn sie alternative Prüfungsformen ermöglichen und eine Prüfungskultur einführen möchten, bei der Lernen und Feedback im Vordergrund stehen?
| Adriane Langela-Bickenbach / Ricarda Dreier / Philippe Wampfler / Christian Albrecht (Hrsg.): Wege zu einer zeitgemäßen Prüfungskultur. Grundlagen und Praxisbeispiele. Weinheim & Basel: Beltz 2024. ISBN: 978-3-407-63311-8, 185 Seiten. |
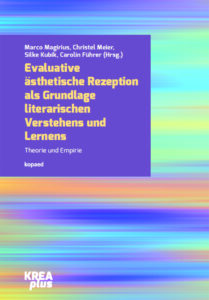 Was geschieht eigentlich genau bei der Begegnung mit ästhetischen Texten? Emotional, kognitiv, aber auch körperlich? Gegenstand dieses Bandes ist das Zusammenspiel der Wahrnehmung literarischer Gegenstände und lektürebegleitender Emotionen beim literarischen Verstehen und Lernen. Zunächst werden die eng mit dem unmittelbaren Wertungsgeschehen verknüpften Lektüreprozesse aus fachwissenschaftlicher und -didaktischer Perspektive u. a. mit Bezug auf Foregrounding- und Embodiment-Theorien ausgeleuchtet. Anschließend werden quantitative und qualitative empirische Zugänge zu Aspekten des Textverstehens präsentiert – z. B. über Lautes Denken. Doch wie vollzieht sich evaluative ästhetische Rezeption im Klassenzimmer? Unterrichtsrekonstruktionen und Interventionsstudien zu literarischen Gesprächen und einem intermedialen Kompetenztraining gewähren hierzu empirische Einblicke. Anregungen für die Unterrichtspraxis runden den Band ab.
Was geschieht eigentlich genau bei der Begegnung mit ästhetischen Texten? Emotional, kognitiv, aber auch körperlich? Gegenstand dieses Bandes ist das Zusammenspiel der Wahrnehmung literarischer Gegenstände und lektürebegleitender Emotionen beim literarischen Verstehen und Lernen. Zunächst werden die eng mit dem unmittelbaren Wertungsgeschehen verknüpften Lektüreprozesse aus fachwissenschaftlicher und -didaktischer Perspektive u. a. mit Bezug auf Foregrounding- und Embodiment-Theorien ausgeleuchtet. Anschließend werden quantitative und qualitative empirische Zugänge zu Aspekten des Textverstehens präsentiert – z. B. über Lautes Denken. Doch wie vollzieht sich evaluative ästhetische Rezeption im Klassenzimmer? Unterrichtsrekonstruktionen und Interventionsstudien zu literarischen Gesprächen und einem intermedialen Kompetenztraining gewähren hierzu empirische Einblicke. Anregungen für die Unterrichtspraxis runden den Band ab.
| Marco Magirius / Christel Meier / Silke Kubik / Carolin Führer (Hrsg.): Evaluative ästhetische Rezeption als Grundlage literarischen Verstehens und Lernens. Theorie und Empirie. Schriftenreihe KREAplus, Band 28, München 2023, 457 Seiten. |
Der literaturdidaktische Diskurs ist von unterschiedlichen Annahmen über Stärken und Schwächen verschiedener Gesprächstypen bestimmt, systematisch empirisch erforscht sind diese bislang allerdings nicht. Diesem Forschungsdesiderat widmet sich das Forschungsprojekt „Ästhetische Kommunikation im Literaturunterricht“ (ÄSKIL), in dem diese Untersuchung zu verorten ist. Auf Basis der Theorie der ästhetischen Erfahrung und der ‚Literary Literacy’ wurde ein operationalisierbares Modell ‚Ästhetische Kommunikation im Literaturunterricht’ entwickelt, das die Zusammenhänge zweier Grundtypen literarischer Gespräche und der durch sie initiierten spezifischen Affordanzen mit literarästhetischen Verstehens- und Erfahrungsprozessen heuristisch abbildet und das in einer videographiegestützten Vergleichsstudie mit Treatment- und Kontrollgruppen (N = 699 Schüler*innen in 34 Gymnasialklassen der 10. Jahrgangsstufe) mit quantitativen und qualitativen Methoden empirisch untersucht worden ist.
| Albrecht, Christian (2022): Literarästhetische Erfahrung und literarästhetisches Verstehen. Eine empirische Studie zu ästhetischer Kommunikation im Literaturunterricht (ÄSKIL). Berlin: J.B. Metzler. |
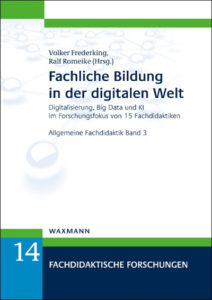 Dieser Band ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus 15 Fachdidaktiken. Auf Einladung der ‚Gesellschaft für Fachdidaktik‘ (GFD) haben diese aus je eigener fachspezifischer Perspektive das Forschungsfeld ‚Fachliche Bildung in der digitalen Welt‘ reflektiert und den fachdidaktischen State of the Art zur digitalen Transformation in ihren Disziplinen nach gemeinsam festgelegten Parametern umfassend aufgearbeitet.
Dieser Band ist das Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus 15 Fachdidaktiken. Auf Einladung der ‚Gesellschaft für Fachdidaktik‘ (GFD) haben diese aus je eigener fachspezifischer Perspektive das Forschungsfeld ‚Fachliche Bildung in der digitalen Welt‘ reflektiert und den fachdidaktischen State of the Art zur digitalen Transformation in ihren Disziplinen nach gemeinsam festgelegten Parametern umfassend aufgearbeitet.
Im Rahmen der Theorie der ‚Allgemeinen Fachdidaktik‘ wird der Forschungsüberblick durch vergleichende Untersuchungen der 15 Fachbeiträge auf Basis der ‚Grounded Theory‘ und durch kritische Analysen zum aktuellen bildungspolitischen Diskurs ergänzt. Diese münden in Schlussfolgerungen für fachdidaktische Bildungsforschung im Zeichen von Digitalisierung, Big Data und KI sowie in Vorschlägen für ein fachdidaktisch begründetes Modell zur empirischen Erforschung fachlicher Bildung in der digitalen Welt.
| Frederking, Volker/Romeike, Ralf (Hrsg.) (2022): Fachliche Bildung in der digitalen Welt. Digitalisierung, Big Data und KI im Forschungsfokus von 15 Fachdidaktiken (=Allgemeine Fachdidaktik Band 3). Münster: Waxmann. |
Welche Fähigkeiten benötigt man für einen kompetenten Umgang mit Sprache in Literatur? Im Zentrum dieser Publikation steht ein Kompetenzmodell „literarästhetischer Sprachreflexion“ mit den Teilfähigkeiten „Sprachwahrnehmung“, „Erfassen der Textstrategie“ und „formspezifisches Fachwissen“. Im ersten Teil widmet sich die Autorin der theoretischen Verortung des Modells in Kognitionspsychologie, Literaturtheorie, Sprach- und Literaturdidaktik. Im zweiten Teil erfolgt die empirische Überprüfung des Modells an Daten von Schüler*innen der zehnten Jahrgangsstufe aus dem DFG-Projekt „Literarästhetische Urteilskompetenz“ (Frederking/Meier/Stanat/Roick). Das methodische Vorgehen versteht sich dabei als exemplarisch für eine empirisch fundierte fachdidaktische Forschung. Diese Arbeit wurde mit dem Habilitationspreis der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg ausgezeichnet.
| Meier, Christel (2022): Kompetenzfacetten literarästhetischer Sprachreflexion. Theoretische Verortung – empirische Analysen – Ansatzpunkte didaktischer Förderung (= Positionen der Deutschdidaktik, Band 15) . Berlin et al.: Peter Lang. |
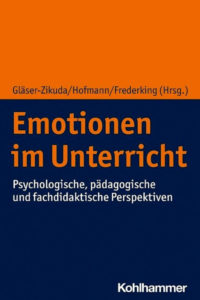 Emotionen sind ausschlaggebend für den Erfolg von Lehr- und Lernprozessen. Ob Kinder gerne in die Schule gehen oder nicht, hängt wesentlich davon ab, ob sie im Unterricht und im Umgang mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern, schulischen Anforderungen und fachlichen Inhalten eher Freude und Stolz oder Ärger und Angst verspüren. Die einzelnen Beiträge des Bandes beleuchten Emotionen von Lernenden und Lehrenden aus erziehungsphilosophischer, bildungstheoretischer, pädagogischer, psychologischer und fachdidaktischer Perspektive. Auch die Frage, ob fachliche Inhalte ein spezifisches emotionales Aktivierungspotenzial haben und in ihnen selbst Emotionen verarbeitet sein können, spielt eine Rolle. Theoretische und empirische Zugänge werden gleichermaßen berücksichtigt.
Emotionen sind ausschlaggebend für den Erfolg von Lehr- und Lernprozessen. Ob Kinder gerne in die Schule gehen oder nicht, hängt wesentlich davon ab, ob sie im Unterricht und im Umgang mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern, schulischen Anforderungen und fachlichen Inhalten eher Freude und Stolz oder Ärger und Angst verspüren. Die einzelnen Beiträge des Bandes beleuchten Emotionen von Lernenden und Lehrenden aus erziehungsphilosophischer, bildungstheoretischer, pädagogischer, psychologischer und fachdidaktischer Perspektive. Auch die Frage, ob fachliche Inhalte ein spezifisches emotionales Aktivierungspotenzial haben und in ihnen selbst Emotionen verarbeitet sein können, spielt eine Rolle. Theoretische und empirische Zugänge werden gleichermaßen berücksichtigt.
| Gläser-Zikuda, Michaela/Hofmann, Florian/Frederking, Volker (Hrsg.) (2022): Emotionen im Unterricht. Psychologische, pädagogische und fachdidaktische Perspektiven. 2. Auflage. Stuttgart: Kohlhammer. |